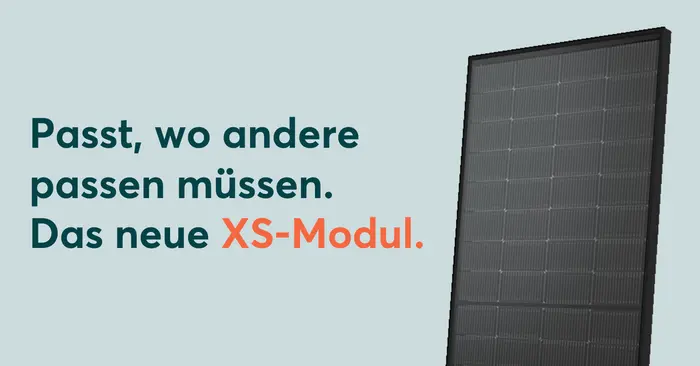Wesentliche Änderungen der EEG Novelle 2023
Wesentliche Änderungen der am 8.7. verabschiedeten EEG Novelle
Allgemeines
Am 8.7. wurde das “Osterpaket” beschlossen. Es beinhalte neben einer Novellierung des bestehenden EEG 2021 auch neue Regelungen mit Wirksamkeit ab 01.01.2023, dem EEG 2023. Wesentliche Änderungen gab es insbesondere in folgenden Bereichen:
- Erhöhung der EEG-Einspeisevergütung
- Abbau bürokratischer Hürden bei
- 70 % Regel
- Steuer
- Netzanschluss
- Mieterstrom
Der Ausbau erneuerbarer Energie wurde im EEG als von „überragendem öffentlichen Interesse“ und wichtig für die „öffentliche Sicherheit“ verankert (§2 EEG). Dadurch ist eine Erleichterung von Gerichtsverfahren im Planungsprozess zu erwarten.
Ziele in Zahlen
Der “atmende Deckel” entfällt, stattdessen werden die Zubauziele für die Photovoltaik bis 2026 schrittweise auf 22 GW pro Jahr angehoben. Im Einzelnen wird in 2022 ein Zubau von 7 GW, in 2023 von 9 GW, in 2024 von 13 GW und in 2025 von 18 GW angestrebt. Bis 2030 soll die installierte PV-Leistung 215 GW erreichen und der Anteil der Photovoltaik am Strommix auf 30 % steigen. Bisher wurden 60 GW und 10 % anvisiert. Für die Umsetzung der Maßnahmen wird ein Finanzierungsbedarf von 20-23 Mrd. € veranschlagt. Allerdings soll die Erneuerbaren-Förderung komplett entfallen, sobald der Kohleausstieg abgeschlossen ist.
Einspeisevergütung
Neu und auch für private Haushalte relevant ist eine Unterscheidung zwischen Voll- und Überschuss-Einspeiseanlagen. Ein Wechsel zwischen beiden Varianten ist jederzeit möglich, allerdings muss beachtet werden, dass beide Anlagen mit separaten Messeinrichtungen gezählt werden.
| Anlagengröße | Vergütung bei Überschusseinspeisung | Vergütung bei Volleinspeisung |
|---|---|---|
| bis 10 kWp | 7,94 Cent | 12,60 Cent |
| bis 40 kWp | 6,88 Cent | 10,56 Cent |
| bis 100 kWp | 5,62 Cent | 10,56 Cent |
* Die neuen Vergütungssätze gelten erst mit Bekanntmachung im Amtsblatt.
Die Einspeisevergütung wird für alle Anlagengrößen deutlich angehoben. Aufgrund der monatlichen Degression war es bisher sinnvoll, die PV-Anlage so früh wie möglich anzumelden. Dieser Zeitdruck entfällt jetzt. Seit 2024 wird die Degression ausgesetzt und erfolgt nur noch halbjährlich.
Um den Volleinspeisebonus zu erhalten, muss der gesamte im Kalenderjahr erzeugte Strom ins Netz eingespeist werden. Zudem muss diese Volleinspeisung bis zum 1.12. für das Folgejahr angemeldet werden. Auch ist die Anmeldung von zwei Anlagen auf einem Dach möglich (eine für Überschusseinspeisung und eine für Volleinspeisung) – ohne wie bisher 12 Monate zwischen dem Anlagenbau warten zu müssen. Dies macht für viele eine Vollbelegung ihres Daches und eine Trennung für Eigenverbrauch- und Volleinspeiseanlage interessant.
Mehr Fläche für PV
Besitzer denkmalgeschützter Gebäude, die keine PV-Anlage auf ihrem Hausdach errichten können, bekommen die Möglichkeit, Solaranlagen „im Garten“ zur errichten. Diese dürfen max. 20 kWp Leistung bringen und höchstens die gleiche Grundfläche wie das Wohngebäude aufweisen.
Vor allem gewerbliche Nutzer und Hausbesitzer mit großen Dächern profitieren von der Regelung, dass in Zukunft die Anmeldung von zwei Anlagen auf einem Dach möglich sein soll. Eine PV-Anlage kann dabei für die Überschusseinspeisung und eine für die Volleinspeisung genutzt werden. Der bisher notwendige Abstand von 12 Monaten zwischen dem Bau beider Anlagen entfällt.
Die Regelung macht die Nachrüstung von Volleinspeise-Anlagen attraktiv, vor allem auf Lagerhäusern, Stallungen und anderen großen Dachflächen. Auch schafft sie einen höheren Anreiz für die Vollbelegung der Dachfläche, insbesondere bei mangelnder Höhe des Eigenverbrauchs (z.B. bei landwirtschaftlichen Betrieben).
Änderungen gibt es auch bei PV-Großprojekten: Um zusätzliche Flächen für die Solarstromgewinnung bereitzustellen, werden die Solar-Randstreifen für Autobahnen und Schienenwege von 200 Meter auf 500 Meter erweitert.
Abbau bürokratischer und technischer Hürden
Steuer
Die Bundesregierung hat zusätzliche Maßnahmen in die Wege geleitet, um steuerliche und bürokratische Hürden für den Betrieb von Photovoltaikanlagen abzubauen. Einnahmen aus der PV und Entnahmen für die Selbstversorgung werden steuerfrei – für Einfamilienhäuser bis zu einer Anlagengröße von 30 kWp, für Mehrfamilienhäuser bis 15 kWp pro Wohn- oder Gewerbeeinheit und bis zu einer Gesamtmenge von 100 kWp.
Für Lieferung und Installation von Photovoltaikanlagen sowie zugehöriger Komponenten und Speicher wird bei Einsatz für Wohnungen und öffentliche Gebäude keine Umsatzsteuer erhoben (Nullsteuersatz). Die Grenze für Befreiung von Ertrag- und Gewerbesteuer wurde von 10 auf 30 kWp angehoben (Photovoltaik ohne Finanzamt). Außerdem dürfen sich private PV-Betreiber mit einer Anlage bis zu 30 kWp künftig von Steuerhilfevereinen unterstützen lassen. Vereinfacht wird auch das Erbrecht für Landwirte, durch die Zuordnung der Agri-PV zum Grundvermögen des landwirtschaftlichen Betriebes.
Netzanschluss
Bei der Inbetriebnahme von PV-Anlagen bis 30 kWp muss der Netzbetreiber nur noch in Ausnahmefällen anwesend sein. Den Besitzer sollte das Anschlussbegehren möglichst frühzeitig beim Netzbetreiber abgeben. Dieser muss dann nur noch eine schriftliche Zusage geben.
Der Netzanschluss und die Übermittlung aller Unterlagen sollen künftig über ein Webportal des Netzbetreibers möglich sein. Dafür werden alle Netzbetreiber vom Gesetzgeber dazu verpflichtet, Webportale mit möglichst einheitlicher Gestaltung einzurichten. Bisher ist jedoch keine Frist zur Umsetzung dieses Vorhabens bekannt.
Mieterstrom
Die Umlagen auf Eigenverbräuche und Direktbelieferungen hinter dem Netzverknüpfungspunkt sollen entfallen. Zudem wird die mengenmäßige Begrenzung der jährlich geförderten Mieterstromprojekte im Erneuerbare-Energien-Gesetz aufgehoben.
Änderungen bei Ausschreibungen
- Gewerbliche Dachanlagen, die sich über Marktprämien finanzieren, müssen künftig nicht mehr an Ausschreibungen teilnehmen
- Ausschreibung für das Optionsmodell mit Eigenverbrauch für Anlagen zwischen 300 und 750 kWp entfällt
- Agri-PV, Floating-PV (schwimmende PV), Moor-PV und Parkplatz-PV werden in die Freiflächenausschreibungen integriert
- Ausschreibungsmengen und Bagatellgrenzen für die Ausschreibungen werden angehoben
- Wind- und Solarprojekte von Bürgerenergiegesellschaften werden von den Ausschreibungen ausgenommen (alle drei Jahre ein ausschreibungsfreies Projekt innerhalb einer Technologie)
Weitere Gesetzesänderungen
Beschlossen wurde auch eine Änderung im Paragraf 14a des Energiewirtschaftsgesetzes. Danach kann die Bundesnetzagentur künftig bundeseinheitliche Vorgaben für die Netzintegration von steuerbaren Verbrauchseinrichtungen und Netzanschlüssen machen. In der Praxis werden dadurch u.a. die Voraussetzung für bidirektionales Laden und zeitvariable Stromtarife geschaffen.
Die wichtigste Änderung aus dem Gebäudeenergiegesetz ist die Anhebung des Neubaustandards auf das Effizienzhaus-55-Niveau. Allerdings werden in diesem Zuge die Anforderungen an den jetzt als GEG-55 bezeichneten Standard reduziert – insbesondere in Hinblick auf die Wärmeabgabe über die Gebäudehülle. An dieser Regelung wurde bereits Kritik von verschiedenen Seiten laut.
Quellen:
- https://www.bundesrat.de/SharedDocs/drucksachen/2022/0301-0400/315-22.pdf?__blob=publicationFile&v=1
- https://www.pv-magazine.de/2022/07/06/osterpaket-verguetung-rauf-buerokratie-runter-netzanschluss-digital-ausschreibungsvolumen-dynamisch/
- https://www.pv-magazine.de/2022/07/08/osterpaket-vom-bundesrat-verabschiedet-die-branche-reagiert-mit-viel-lob-und-ein-bisschen-kritik/
- https://www.bundestag.de/dokumente/textarchiv/2022/kw27-de-energie-902620
- https://www.handelsblatt.com/politik/deutschland/energiewende-bundestag-beschliesst-booster-fuer-erneuerbare-energie-und-kippt-oekostrom-ziel-fuer-2035/28487532.html
- https://www.wiwo.de/politik/deutschland/energiewende-bundestag-beschliesst-gesetze-zum-beschleunigten-oekostrom-ausbau/28487738.html
- https://www.heise.de/news/Osterpaket-E-Fahrzeuge-koennen-kuenftig-als-Stromspeicher-genutzt-werden-7167591.html
- https://www.klimareporter.de/strom/kanzler-verteidigt-ende-der-erneuerbaren-foerderung
- https://stiftung-umweltenergierecht.de/wp-content/uploads/2022/04/EEG-spezial-28.4.2022.pdf
- http://www.bgbl.de/xaver/bgbl/start.xav?startbk=Bundesanzeiger_BGBl&jumpTo=bgbl122s1213.pdf